Framing: Die unsichtbare Macht der Deutungsrahmen
Allgemeine Einleitung des Autors
Propaganda ist die Manipulation von Massen mittels Medien. In dieser Serie tauchen wir tief in die Mechanismen der Beeinflussung ein, um zu verstehen, wie unsere Wahrnehmung geformt wird und wie wir uns davor schützen können. Jeder Beitrag beleuchtet eine spezifische Technik, ihre Funktionsweise und praktische Wege zur Entlarvung.
Propagandatechnik
Framing gehört zu den subtilsten und wirkungsvollsten Propagandatechniken der modernen Medienlandschaft. Der Begriff stammt aus der Kognitionswissenschaft und beschreibt, wie durch die Wahl bestimmter Worte, Bilder und Kontexte ein „Deutungsrahmen“ geschaffen wird, der unsere Wahrnehmung und Bewertung von Ereignissen, Personen oder Sachverhalten lenkt. Anders als bei offensichtlicher Propaganda arbeitet Framing meist unbewusst und erscheint dem Rezipienten als objektive Berichterstattung.
Die Macht des Framing liegt in seiner Fähigkeit, dieselben Fakten völlig unterschiedlich erscheinen zu lassen, ohne dabei zu lügen. Durch die Auswahl bestimmter Aspekte, die Betonung spezifischer Details und die Verwendung emotional aufgeladener Begriffe wird ein kognitiver Rahmen geschaffen, der unser Denken kanalisiert. Medien nutzen Framing durch Schlagzeilen, Bildauswahl, Quellenauswahl und die Reihenfolge der Informationspräsentation. Besonders wirkungsvoll ist diese Technik, weil sie an bestehende mentale Modelle und Vorurteile anknüpft und diese verstärkt.
Die psychologischen Mechanismen des Framing basieren auf der Art, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Menschen kategorisieren neue Informationen automatisch in bereits bestehende mentale Schemata. Durch geschicktes Framing können Medien bestimmen, welches Schema aktiviert wird. Ein Ereignis kann als „Krise“ oder „Herausforderung“, eine Person als „Kämpfer“ oder „Extremist“, eine Politik als „Reform“ oder „Angriff“ geframt werden. Jeder Frame aktiviert unterschiedliche Assoziationen und Emotionen und führt zu verschiedenen Schlussfolgerungen, obwohl die zugrundeliegenden Fakten identisch sind.
Zur Erkennung von Framing ist es wichtig, auf die verwendete Sprache zu achten, alternative Darstellungen derselben Ereignisse zu suchen und sich bewusst zu machen, welche Aspekte betont oder ausgelassen werden. Kritische Medienkompetenz erfordert die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und die impliziten Botschaften zu erkennen, die durch die Art der Präsentation vermittelt werden.
Anwendungsbeispiele
Die folgenden Beispiele sind bewusst fiktiv gewählt, um die Mechanismen zu verdeutlichen, ohne reale Personen oder Ereignisse zu diskreditieren:
Beispiel 1 – Wirtschaftsberichterstattung: Dieselbe Arbeitslosenstatistik wird unterschiedlich geframt: „Arbeitslosigkeit steigt auf besorgniserregende 8%“ versus „Beschäftigung erreicht stabiles Niveau von 92%“. Beide Aussagen sind faktisch korrekt, erzeugen aber völlig unterschiedliche Eindrücke über die wirtschaftliche Lage. Das erste Frame aktiviert Sorge und Krisenstimmung, das zweite vermittelt Stabilität und Optimismus.
Beispiel 2 – Politische Berichterstattung: Ein fiktiver Politiker kündigt Steuererhöhungen an. Frame A: „Politiker belastet hart arbeitende Familien mit neuen Steuern“. Frame B: „Regierung investiert in Zukunft durch gerechte Beiträge“. Derselbe Sachverhalt wird einmal als Belastung, einmal als Investition dargestellt, was zu grundlegend verschiedenen Bewertungen führt.
Beispiel 3 – Gesellschaftliche Themen: Eine Demonstration wird unterschiedlich geframt: „Besorgte Bürger gehen für ihre Rechte auf die Straße“ versus „Radikale Gruppen stören die öffentliche Ordnung“. Die Wahl zwischen „besorgte Bürger“ und „radikale Gruppen“ sowie zwischen „für Rechte eintreten“ und „Ordnung stören“ schafft völlig verschiedene Narrative über dasselbe Ereignis.
Beispiel 4 – Internationale Berichterstattung: Ein militärischer Einsatz wird als „Friedensmission zur Stabilisierung“ oder als „Invasion zur Ressourcensicherung“ geframt. Beide Frames können sich auf dieselben Handlungen beziehen, erzeugen aber völlig unterschiedliche moralische Bewertungen und emotionale Reaktionen beim Publikum.
Beispiel 5 – Gesundheitsthemen: Eine neue Behandlungsmethode wird entweder als „revolutionärer Durchbruch mit 70% Erfolgsrate“ oder als „riskantes Experiment mit 30% Versagensrate“ dargestellt. Mathematisch identisch, emotional und in der Wahrnehmung grundverschieden.
Weiterführende Literatur
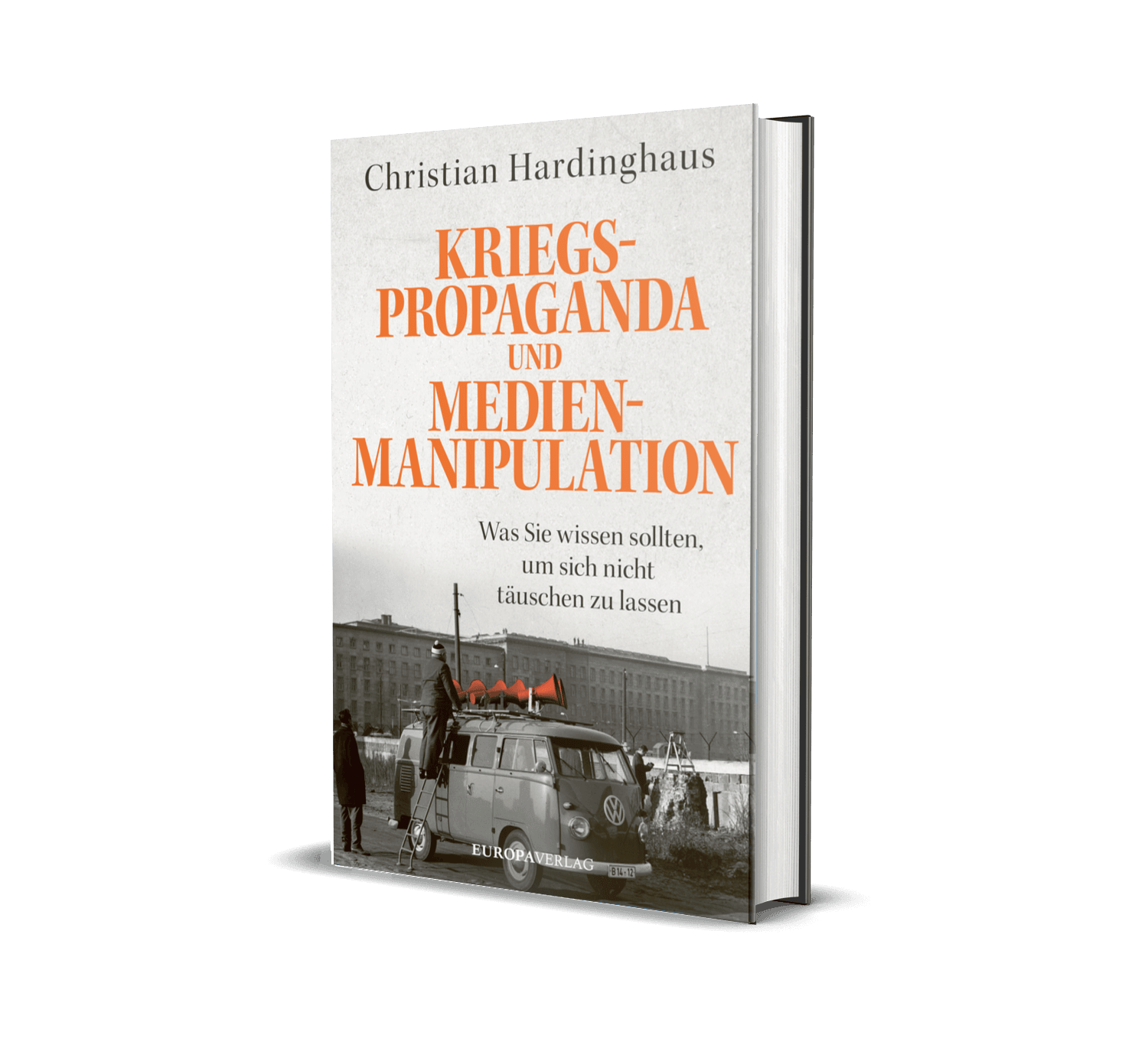
Hardinghaus, Christian: „Kriegspropaganda und Medienmanipulation. Was Sie wissen sollten, um sich nicht täuschen zu lassen.“
Weiterführende Informationen
- Lakoff, George (2014): Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. Chelsea Green Publishing.
- Entman, Robert M. (1993): Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.
- Wehling, Elisabeth (2016): Politisches Framing: Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht. Herbert von Halem Verlag.
- Kahneman, Daniel & Tversky, Amos (1984): Choices, values, and frames. American Psychologist, 39(4), 341-350.
- Scheufele, Dietram A. (1999): Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49(1), 103-122.
- Matthes, Jörg (2014): Framing. Nomos Verlag.


