Card Stacking: Die Kunst der selektiven Wahrheit
Allgemeine Einleitung des Autors
Propaganda ist die Manipulation von Massen mittels Medien. In dieser Serie tauchen wir tief in die Mechanismen der Beeinflussung ein, um zu verstehen, wie unsere Wahrnehmung geformt wird und wie wir uns davor schützen können. Jeder Beitrag beleuchtet eine spezifische Technik, ihre Funktionsweise und praktische Wege zur Entlarvung.
Propagandatechnik
Card Stacking, auch als „Stacking the Deck“ oder „Cherry Picking“ bekannt, ist eine der raffiniertesten Propagandatechniken der modernen Medienlandschaft. Der Begriff stammt aus dem Kartenspiel und beschreibt das Mischen der Karten zu eigenem Vorteil. In der Medienwelt bedeutet Card Stacking die gezielte Auswahl und Präsentation nur derjenigen Fakten, Statistiken, Zitate oder Ereignisse, die eine bestimmte Sichtweise stützen, während widersprechende oder relativierende Informationen systematisch ausgelassen werden.
Das Perfide an dieser Technik ist, dass alle präsentierten Informationen faktisch korrekt sein können. Die Manipulation liegt nicht in der Verfälschung einzelner Fakten, sondern in der selektiven Zusammenstellung und dem bewussten Weglassen wichtiger Kontextinformationen. Card Stacking nutzt die menschliche Tendenz, aus verfügbaren Informationen Schlüsse zu ziehen, ohne zu hinterfragen, welche Informationen möglicherweise fehlen. Diese Technik ist besonders wirkungsvoll, weil sie den Anschein von Objektivität und Faktentreue erweckt.
Die psychologischen Mechanismen des Card Stacking basieren auf dem Verfügbarkeitsheuristik-Prinzip: Menschen bewerten die Wahrscheinlichkeit oder Wichtigkeit von Ereignissen basierend auf den Informationen, die ihnen leicht verfügbar sind. Wenn Medien systematisch nur bestimmte Aspekte eines Themas beleuchten, entsteht beim Publikum ein verzerrtes Bild der Realität. Besonders effektiv ist diese Technik bei komplexen Themen, wo das Publikum nicht über die Zeit oder Expertise verfügt, um selbst umfassende Recherchen durchzuführen.
Card Stacking manifestiert sich in verschiedenen Formen: selektive Statistikpräsentation, einseitige Expertenauswahl, das Hervorheben bestimmter Studien während andere ignoriert werden, oder die Fokussierung auf spezifische Zeiträume, die eine gewünschte Entwicklung zeigen. Zur Erkennung dieser Technik ist es wichtig, nach fehlenden Informationen zu suchen, alternative Quellen zu konsultieren und sich zu fragen: „Was wird hier nicht gesagt?“ Kritische Medienkompetenz erfordert die Fähigkeit, das Gesamtbild zu betrachten und bewusst nach den „anderen Karten im Deck“ zu suchen.
Anwendungsbeispiele
Die folgenden Beispiele sind bewusst fiktiv gewählt, um die Mechanismen zu verdeutlichen, ohne reale Personen oder Ereignisse zu diskreditieren:
Beispiel 1 – Wirtschaftsstatistiken: Ein Medienbericht über die Wirtschaftslage präsentiert ausschließlich positive Arbeitsmarktdaten aus den letzten drei Monaten, während die langfristige Entwicklung, regionale Unterschiede und die Qualität der neuen Arbeitsplätze verschwiegen werden. Gleichzeitig werden nur Experten zitiert, die optimistische Prognosen abgeben, während kritische Stimmen oder Warnungen vor strukturellen Problemen komplett ausgeblendet werden.
Beispiel 2 – Gesundheitsberichterstattung: Bei der Berichterstattung über ein neues Medikament werden ausschließlich Studien erwähnt, die positive Ergebnisse zeigen, während Studien mit negativen oder gemischten Resultaten nicht erwähnt werden. Nebenwirkungen werden nur oberflächlich behandelt, und Langzeitstudien, die noch ausstehen, werden nicht thematisiert. Patientenberichte werden selektiv ausgewählt, um nur Erfolgsgeschichten zu präsentieren.
Beispiel 3 – Politische Berichterstattung: Die Berichterstattung über einen fiktiven Politiker konzentriert sich ausschließlich auf seine Erfolge und positiven Aussagen, während Kontroversen, gescheiterte Projekte oder kritische Stimmen aus der eigenen Partei systematisch ausgeblendet werden. Umfragen werden nur dann zitiert, wenn sie günstige Ergebnisse zeigen, und der historische Kontext seiner politischen Entscheidungen wird weggelassen.
Beispiel 4 – Umweltthemen: Ein Bericht über Klimawandel präsentiert ausschließlich Daten, die eine bestimmte Position stützen, während wissenschaftliche Unsicherheiten, abweichende Studien oder komplexe Wechselwirkungen nicht erwähnt werden. Nur Wissenschaftler mit einer bestimmten Meinung kommen zu Wort, während die Bandbreite der wissenschaftlichen Diskussion verschleiert wird.
Beispiel 5 – Technologieberichterstattung: Bei der Vorstellung einer neuen Technologie werden nur die Vorteile und Erfolgsgeschichten hervorgehoben, während Risiken, ethische Bedenken, Datenschutzprobleme oder gescheiterte Implementierungen verschwiegen werden. Kritische Experten werden nicht zitiert, und mögliche negative gesellschaftliche Auswirkungen bleiben unerwähnt.
Weiterführende Literatur
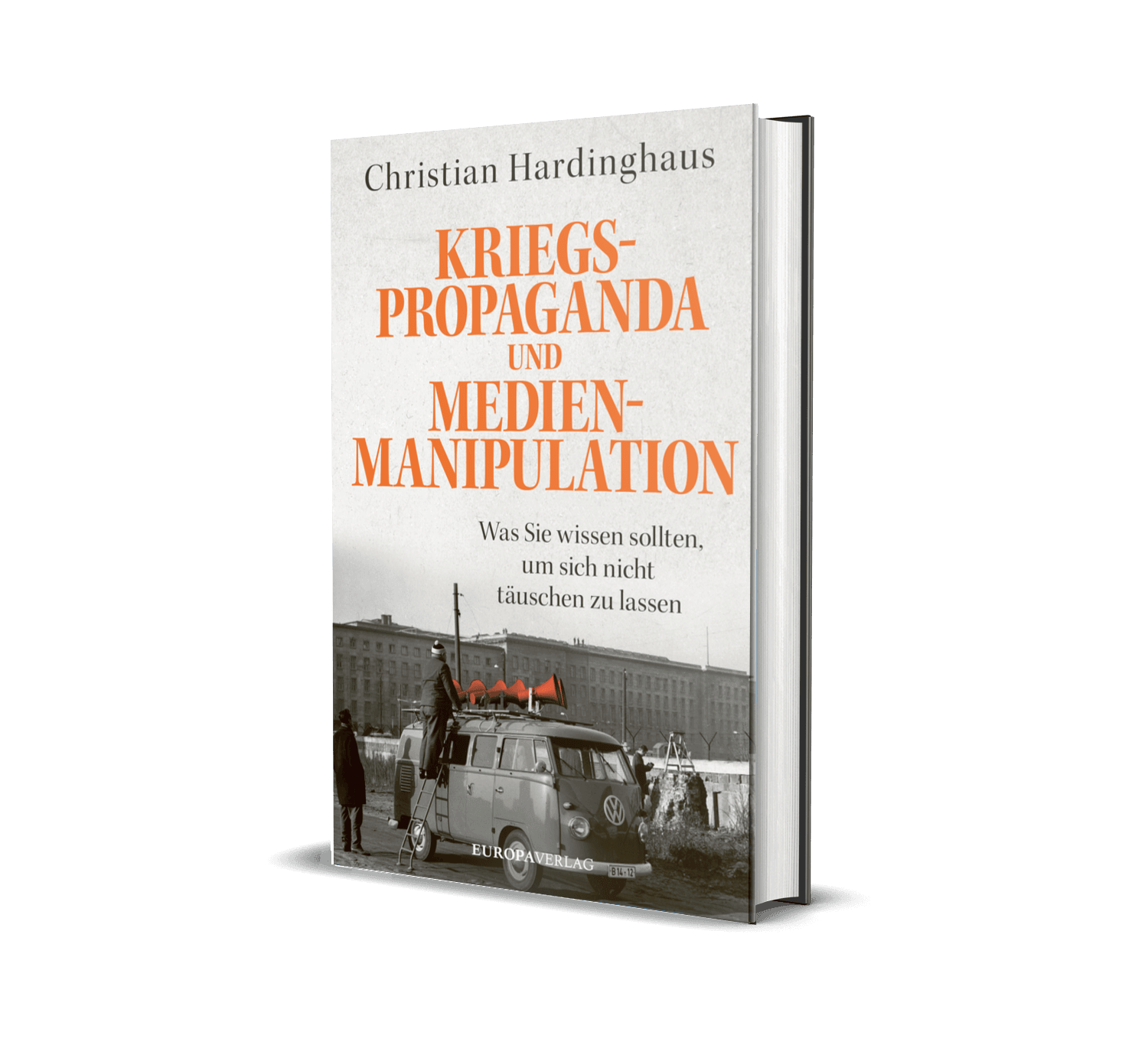
Hardinghaus, Christian: „Kriegspropaganda und Medienmanipulation. Was Sie wissen sollten, um sich nicht täuschen zu lassen.“
Weiterführende Informationen
- Miller, Clyde R. (1939): The Process of Persuasion. Crown Publishers. (Erstbeschreibung der Card Stacking Technik)
- Pratkanis, Anthony & Aronson, Elliot (2001): Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. W. H. Freeman and Company.
- Klayman, Joshua & Ha, Young-Won (1987): Confirmation, disconfirmation, and information in hypothesis testing. Psychological Review, 94(2), 211-228.
- Nickerson, Raymond S. (1998): Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220.
- Gilovich, Thomas (1991): How We Know What Isn’t So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. Free Press.
- Mercier, Hugo & Sperber, Dan (2017): The Enigma of Reason. Harvard University Press.


